![Kostenvergleichsrechnung - Erläuterung mit Beispiel]()
Im Beitrag
Statische Investitionsrechnung wurden die Grundlagen des statischen Ansatzes inkl. der Diskussion der Prämissen gelegt. Auf dieser Basis soll nun die
Kostenvergleichsrechnung behandelt werden.
Das einfachste Verfahren der
Investitionsrechnung besteht in der Kostenvergleichsrechnung. Sie basiert auf der Prämisse, dass die Nutzenseite aller Handlungsmöglichkeiten (weitgehend) gleich ist, vernachlässigt werden kann oder nicht relevant ist. Dazu reicht es nicht, dass die Umsätze übereinstimmen, sondern es muss zusätzlich gewährleistet sein, dass
sonstige Nutzenelemente wie z. B. Garantie, Kundendienst, Image, Umweltaspekte keine oder nur eine geringe Rolle spielen.
Dies sei am Kauf eines LKW verdeutlicht. Wenn die
Anforderungen (Spezifikationen) hinsichtlich Nutzlast, Beschleunigung, Geschwindigkeit, Image für den Fahrer, Wendekreis, Ergonomie, Service (Notfall und allgemein) etc. erfüllt sind, kann die
Entscheidung ohne Berücksichtigung der Nutzenseite erfolgen. Der
Endkunde eines
Produktes wird nicht bereit sein, mehr zu bezahlen, wenn seine Ware bei sonst gleichen Eigenschaften durch einen bestimmten LKW transportiert wurde.
Das
Auswahlkriterium besteht darin, dass diejenige
Handlungsmöglichkeit optimal ist, welche die geringsten Gesamtkosten der Durchschnittsperiode aufweist. Die Gesamtkosten GK der statischen Kostenvergleichsrechnung ergeben sich gemäß der folgenden Formel aus 3 Elementen:
GK = Klfd + WV + KKK in €/DP
GK
|
– Gesamtkosten pro Durchschnittsperiode in €/DP
|
Klfd
|
– Laufende Kosten pro Durchschnittsperiode in €/DP
|
|
WV
|
– Durchschnittlicher Wertverzehr (Kalk. Abschreibung) in der Durchschnittsperiode in €/DP
|
KKK
|
– Kalkulatorische Kapitalkosten (Zinsen) der Durchschnittsperiode in €/DP
|
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass €/DP bedeutet, dass die
Kosten in der Mitte der
Durchschnittsperiode anfallen, was später geprüft werden muss.
Die laufenden Kosten K
lfd umfassen alle
variablen und fixen Kosten, welche nicht direkt auf die Auszahlung für das oder die Investitionsobjekt(e) zurückzuführen sind. Denn die
Investitionen verursachen den Wertverzehr und die Zinsen, was separat in den beiden folgenden Größen WV und KKK abgebildet wird. Der Ausweis der variablen Kosten in den laufenden Kosten ist besonders wichtig, wenn sich die
Maximalmengen z. B. von Maschinen unterscheiden.
Anzeige
Neben aktuellen Fach- und Arbeitsmarkt-Trends für Controller und neu eingegangene Fachbeiträge, informieren wir Sie über interessante Veranstaltungen und stellen Ihnen einzelne Software- Produkte im Detail vor. Werden Sie jetzt monatlich über neue Fachbeiträge, Controlling-Tools und News informiert! Zur Newsletter-Anmeldung >>
Wertverzehr WV
Der durchschnittliche Wertverzehr WV ist in der statischen Rechnung wie folgt
definiert:
A0
|
– Anschaffungsauszahlung in t = 0
|
RWtn
|
– Restwert netto in € (implizit am Ende t = tn)
|
tn
|
– Anzahl Perioden (Planungszeitraum)
|
Der durchschnittliche Wertverzehr WV in der Durchschnittsperiode ergibt sich somit dadurch, dass der
absolute Wertverzehr (Anschaffungsauszahlung abzüglich Netto–Restwert RW
tn) durch die Anzahl der Perioden tn dividiert wird. Dies entspricht der Methode der linearen Abschreibung.
Es muss erwähnt werden, dass in der Realität der Restwert am Ende einer Handlungsmöglichkeit auch negativ sein kann. Gute Beispiele liefert die
Energiewirtschaft. Die stillgelegten Atomkraftwerke müssen abgebaut und mit hohen Kosten entsorgt werden. In solchen Fällen muss der Wertverzehr entsprechend höher angesetzt werden.
Kalkulatorische Kapitalkosten KKK
Die kalkulatorischen Kapitalkosten KKK sind wie folgt definiert
i – Periodenzinssatz (interest), meist jährlich
Die kalkulatorischen Kapitalkosten KKK werden ermittelt, indem zunächst die Höhe des durchschnittlich gebundenen Kapitals berechnet wird. Es ergibt sich als
arithmetisches Mittel aus der Anschaffungsauszahlung A
0 und dem Netto–Restwert RW
tn. Wenn die Anschaffungsauszahlung 200 T€ beträgt und der Netto–Restwert 40 T€, so erhält man als
durchschnittliche Kapitalbindung:
Am Rande sei erwähnt, dass die durchschnittliche Kapitalbindung in seltenen Fällen auch über einen
Stufenansatz ermittelt wird, indem der Wertverzehr nicht kontinuierlich, sondern immer erst nach einer Periode berechnet wird, was zu höheren Kapitalbindungen führt. Das
gebundene Kapital wird mit dem Periodenzinssatz multipliziert (vgl. zu dessen Ableitung Hoberg (2019), S. 1 ff.).
Es muss festgehalten werden, dass die Dauer der Kapitalbindung nicht in die Berechnung der Kapitalkosten eingeht, weil ja nur eine Periode, nämlich die Durchschnittsperiode, betrachtet wird. Damit wird aber die Abnahme der Kapitalbindung im Zeitablauf nicht korrekt dargestellt. Die
Zinskosten werden damit unterschätzt.
Weitere Grenzen der statischen Investitionsrechnung zeigen sich dadurch, dass im
Zeitverlauf unterschiedliche Zinssätze nicht abgebildet werden können.
Das folgende
Beispiel möge die Rechenweise der statischen Kostenvergleichsrechnung zeigen:
Anschaffungsauszahlung A0 200.000 € in t = 0
Laufzeit tn – 8 Jahre
Restwert netto RWtn – 40.000 € in t = tn = 8
Laufende Kosten Klfd – 33.000 € in der Mitte der Durchschnittsperiode
Jahreszinssatz – 10 %
Mit diesen Beispieldaten ergeben sich die Gesamtkosten GK wie folgt:
|
GK
|
=
|
33.000 +
|
160.000
|
+
|
(200.000 + 40.000)
|
× 0,1
|
=
|
65.000 in €/DP
|
|
8
|
2
|
Wenn diese Handlungsmöglichkeit die
geringsten Kosten von allen möglichen Handlungsmöglichkeiten aufweist, wird sie durchgeführt. Es sei die Anwendungsvoraussetzung für diese Aussage wiederholt, dass nämlich die konkurrierenden Handlungsmöglichkeiten in den übrigen (auch qualitativen) Kriterien weitgehend gleiche Werte aufweisen.
Analyse alternativer Handlungsmöglichkeiten
Unter dieser Bedingung seien die folgenden Beispiele diskutiert:
|
Zinssatz (wacc) p.a.:
|
10 %
|
|
|
|
Einheit
|
HM1
|
HM2
|
HM3
|
HM4
|
HM5
|
HM6
|
|
1
|
Anschaffungspreis
|
T€0
|
200
|
240
|
160
|
160
|
0
|
350
|
|
2
|
Nutzungsdauer tn
|
a
|
8
|
10
|
8
|
5
|
4
|
ewig
|
|
3
|
Restwert netto in t = tn
|
T€ in tn
|
40
|
60
|
–40
|
40
|
0
|
350
|
|
4
|
Laufende Kosten
|
T€ / DP
|
33
|
33
|
33
|
33
|
70
|
33
|
|
5
|
Umsatz
|
T€ / DP
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Absoluter Wertverzehr
|
T€
|
160
|
180
|
200
|
120
|
0
|
0
|
|
7
|
Ø Kapitalbindung
|
T€
|
120
|
150
|
60
|
100
|
0
|
350
|
|
8
|
Werteverzehr (kalk. AfA)
|
T€ / DP
|
20,0
|
18,0
|
25,0
|
24,0
|
0,0
|
0,0
|
|
9
|
Kalkulatorische Zinsen
|
T€ / DP
|
12,0
|
15,0
|
6,0
|
10,0
|
0,0
|
35,0
|
|
10
|
Summe Kosten
|
T€ / DP
|
65,0
|
66,0
|
64,0
|
67,0
|
70,0
|
68,0
|
Abb. 1: Beispiele für die Kostenvergleichsrechnung
T€ / DP – T€ in der Mitte der Durchschnittsperiode
HM – Handlungsmöglichkeiten
Handlungsmöglichkeit 1
Die erste Spalte enthält die Handlungsmöglichkeit (HM1), welche oben als Beispiel besprochen wurde. Die
jährlichen Durchschnittskosten betragen wieder 65 T€ in der Mitte der Durchschnittsperiode (Zeile 10 in Abb. 1).
Handlungsmöglichkeit 2
HM2 ist in der Anschaffung mit 240 T€
0 deutlich teurer (Zeile 1 in Abb. 1), aber hält auch 2 Jahre länger (Zeile 2) und hat mit 60 T€
10 einen etwas höheren
Restwert. In Zeile 6 wird zunächst der absolute Wertverzehr von 180 T€ ermittelt, der sich über die gesamte Laufzeit ergibt, oder 18 T€/DP (Zeile 8).
Die
durchschnittliche Kapitalbindung (in Zeile 7) beläuft sich auf (240+60)/2 = 150 T€. Bei 10% Zinssatz bedeutet dies kalkulatorischen Zinsen (Kapitalkosten) von 15 T€/DP in Zeile 9. Zusammen mit den laufenden jährlichen Kosten von 33 T€/DP (Zeile 4) erhält man für HM2 die jährlichen Gesamtkosten zu 66 T€/DP. Rein finanziell betrachtet ist HM2 damit etwas schlechter als die oben diskutierte HM1.
Handlungsmöglichkeit 3
HM3 hat einen deutlich
geringeren Kaufpreis, weil am Ende ein
negativer Restwert zu beachten ist. Trotzdem ist sie mit 64 T€/DP etwas günstiger als HM1.
Handlungsmöglichkeit 4
In HM4 wird versucht, mit einer
kürzer laufenden Handlungsmöglichkeit von 5 Jahren von einem geringeren Kaufpreis zu profitieren. Aber durch die kurze Laufzeit ist die jährliche Amortisation (zu) hoch.
Handlungsmöglichkeit 5
Für HM5 wurde ein 4–jähriges
Mietmodell angenommen, so dass keine Anfangsinvestition notwendig wird. Allerdings beträgt die Miete 37 T€ pro Jahr zur Jahresmitte, so dass die Gesamtbelastung mit 70 T€/DP zu hoch liegt.
Aber es ist zu klären, ob eine kurze Laufzeit auch Vorteile hat, weil dann schneller auf eine modernere Maschine umgestellt werden kann. Andererseits können
Preissteigerungen eintreten, so dass es dann teurer wird. Es tritt wie immer bei unterschiedlichen Laufzeiten das Problem auf, was in der Zeit passiert zwischen dem Ende der jeweiligen Handlungsmöglichkeit und dem Ende der am längsten laufenden Handlungsmöglichkeit.
Handlungsmöglichkeit 6
Extrem ist HM6. Der Preis ist zwar sehr hoch, aber dafür wird von einer sehr
langen Laufzeit ausgegangen, die im Extremfall unendlich lange sein kann. Damit gibt es keinen Wertverzehr (siehe Zeile 8) und der Restwert ist so hoch wie die Anschaffungsauszahlung. Negativ ist dies für die Kapitalbindung, weil diese nicht sinkt, so dass hohe Kapitalkosten resultieren.
Zudem haben teurere Maschinen meistens eine höhere jährliche
Ausbringungsmenge. Solange auch die kleinste Maschine die maximal mögliche Absatzmenge im gesamten Planungszeitraum schafft, kann der statische Kostenvergleich ausreichen. Wenn aber die Absatzmengen über der
Kapazität der kleinen Maschinen liegt, sollte eine
Gewinnschwellenanalyse (
Break–even–Analyse) durchgeführt werden. Mit ihr kann dann ermittelt werden, ab welcher Menge die größeren Maschinen vorteilhaft werden (vgl. zu dieser Break–even–Analyse (Varnholt/Lebefromm/Hoberg, S. 440 ff.).
Probleme der Kostenvergleichsrechnung
Auch wenn die statische Kostenvergleichsrechnung in einfachen Fällen eingesetzt werden kann, so darf neben dem Vorteil der Einfachheit nicht der Preis dafür verschwiegen werden:
- Nichtberücksichtigung von Zinseszinsen und Zinssatzänderungen
- Durchschnittskosten sind ungenau, bzw. wenn sie exakt ermittelt werden, liegen bereits die Daten für eine dynamische Rechnung vor.
- Kalkulation mit Kosten statt mit Auszahlungen (dieser Kritikpunkt kann teilweise durch die intraperiodische Verzinsungen überwunden werden)
- Implizite Annahme, dass bei einem Vergleich von verschiedenen Handlungsmöglichkeiten die kürzer laufenden Handlungsmöglichkeiten mit den gleichen Kosten wiederholt werden können.
- Unbegrenzte Finanzierungsmöglichkeiten werden vorausgesetzt.
- Mehrstufige Projekte können nicht abgebildet werden
- Die Verzinsung des Restwertes wird per Jahresende gerechnet, obwohl die anderen Größen auf die Jahresmitte bezogen sind.
- Die Abschreibungen sind rein zeitabhängig. Das Beispiel von Fahrzeugen zeigt, dass ein wesentlicher Teil von der Fahrstrecke abhängt.
- Durch die vereinfachte Abbildung der Zinsen, können Paradoxa auftauchen, so dass bei hohen Zinssätzen und Laufzeiten die Kosten steigen, wenn der Restwert sich erhöht (vgl. zu den Details Hoberg (2013), S. 28 ff.).
- Implizite Annahme, dass die Nutzenseite hinsichtlich erzielbarer Umsatzerlöse und qualitativer Faktoren bei allen Handlungsmöglichkeiten (nahezu) gleich ist.
Wenn die letzte Bedingung hinsichtlich der Gleichheit der Nutzenseite (erzielbare Umsatzerlöse und qualitative Faktoren) nicht erfüllt ist, so darf die
Kostenvergleichsrechnung nicht mehr angewendet werden, sondern es ist bei unterschiedlichen Umsätzen z. B. die statische Gewinnvergleichsrechnung zu wählen. Noch besser wäre es, wenn der Controller gleich zu den dynamischen Verfahren wechseln würde.
Wenn nur die qualitativen Aspekte in die
Beurteilung einfließen sollen, so wäre das Verfahren der
Total Cost of Ownership plus (
TCOplus) zu verwenden (vgl. zur Vorgehensweisen Hoberg (2023), S. 1 ff.)
Eine Eignung der Kostenvergleichsrechnung kann bei
Rationalisierungs– und
Ersatzinvestitionen vorliegen, weil nach der Investition häufig gleich hohe Kostenreduktionen über die Jahre kommen, die üblicherweise über das Jahr gleichmäßig (und nicht einseitig saisonal) verteilt liegen. Dann ist die Annahme des durchschnittlichen Anfalls zur Periodenmitte gerechtfertigt. Ähnliches gilt, wenn ein Wirtschaftgut gegen eine fixe Monatsgebühr fest gemietet wird. Wenn es sich um eine Jahresgebühr handelt, müsste diese auf die Jahresmitte bezogen werden.
Übungsaufgabe
Gegeben seien die Daten der folgenden Handlungsmöglichkeiten. Der Zinssatz sei auf 12% gestiegen:
|
Zinssatz (wacc) p.a.:
|
12 %
|
|
|
|
Einheit
|
HM1
|
HM2
|
HM3
|
HM4
|
HM5
|
HM6
|
|
1
|
Anschaffungspreis
|
T€0
|
480
|
500
|
460
|
350
|
0
|
900
|
|
2
|
Nutzungsdauer tn
|
a
|
8
|
10
|
6
|
4
|
2
|
ewig
|
|
3
|
Restwert netto in t = tn
|
T€ in tn
|
120
|
80
|
–20
|
40
|
0
|
900
|
|
4
|
Laufende Kosten
|
T€ / DP
|
100
|
90
|
90
|
90
|
185
|
100
|
|
5
|
Umsatz
|
T€ / DP
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Absoluter Wertverzehr
|
T€
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Ø Kapitalbindung
|
T€
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Werteverzehr (kalk. AfA)
|
T€ / DP
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Kalkulatorische Zinsen
|
T€ / DP
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Summe Kosten
|
T€ / DP
|
|
|
|
|
|
|
Abb. 2: Daten für die Übungsaufgaben
T€ / Dp – T€ in der Mitte der Durchschnittsperiode
HM – Handlungsmöglichkeit
Aufgaben:
- Zu ermitteln sind die Gesamtkosten nach dem Verfahren der statischen Kostenvergleichsrechnung
- Welche Handlungsmöglichkeit ist die beste?
- Was sind die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit das Ergebnis akzeptiert werden kann?
Die Lösungsvorschläge werden umgehend im Controlling–Portal veröffentlicht.
Zusammenfassung
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass der statische Kostenvergleich sehr einfach durchgeführt werden kann, aber viele Probleme aufweist. Insbesondere die Abbildung der
Kapitalkosten über das durchschnittlich gebundene Kapital ermöglicht Paradoxa.
Angesichts der zahlreichen Probleme sollten auch die vielen Unternehmen, die heute noch statisch rechnen, diese Verfahren aufgeben. An ihrer Stelle empfehlen sich vollständige
Finanzpläne (
VoFis), die methodisch überlegen sind und durch den Einsatz von Tabellenkalkulationen leicht handhabbar sind.
Wenn trotzdem noch statisch gerechnet werden soll, müssen die oben genannten Voraussetzungen eingehalten werden. Zudem sollten die Ergebnisse auf das etwaige Vorliegen von Paradoxa und Problemen überprüft werden.
Literaturverzeichnis
- Hoberg, P. (2004): Wertorientierung: Kapitalkosten im internen Rechnungswesen – Die Einführung von Bezugszeitpunkten in die Kosten– und Leistungsrechnung, in: ZfCM, 48. Jg., 4/2004, S. 271–279.
- Hoberg, P. (2007): Statische Investitionsrechnung (I) und (II), in: WISU 1/2007, S. 75–81 und WISU 2/2007, S. 204–210.
- Hoberg, P. (2010): Investitionsrechnung: Korrekte Datenermittlung und –aufbereitung bei intraperiodischen Verzinsungen, in WiSt 8/2010, 39. Jg. S. 412–415.
- Hoberg, P. (2013): Das Renditeparadoxon in der statischen Investitionsrechnung, in: Controllermagazin, Heft 6/13, 39. Jg., S. 28–31.
- Hoberg, P. (2018): Einheiten in der Investitionsrechnung, in: WISU, 47. Jg., 4/2018, S. 468–474.
- Hoberg, P. (2019): Ableitung des Kalkulationszinssatzes (Vergleichszinssatz) für die Investitionsrechnung, in: https://www.controllingportal.de/Fachinfo/Investitionsrechnung/Ableitung-des-Kalkulationszinssatzes-....
- Hoberg, P. (2023): Von Total Cost of Ownership (TCO) zu TCOplus, in: https://www.controllingportal.de/Fachinfo/Investitionsrechnung/von-total-cost-of-ownership-tco-zu-tc....
- Varnholt, N., Hoberg, P., Wilms, S., Lebefromm, U.: Betriebswirtschaftliche Grundlagen und Umsetzung mit SAP®S/4HANA, Berlin/Boston 2023. Varnholt, N., Hoberg, P., Gerhards, R., Wilms, S., Lebefromm, U.: Operatives Controlling und Kostenrechnung – Betriebswirtschaftliche Grundlagen und Anwendung mit SAP S4/HANA, 3. Auflage, Berlin/Boston 2020.

letzte Änderung P.D.P.H.
am 03.06.2025
Autor:
Prof. Dr. Peter Hoberg
|
Autor:in
 |
Herr Prof. Dr. Peter Hoberg
Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Worms. Seine Lehrschwerpunkte sind Kosten- und Leistungsrechnung, Investitionsrechnung, Entscheidungstheorie, Produktions- und Kostentheorie und Controlling. Prof. Hoberg schreibt auf Controlling-Portal.de regelmäßig Fachartikel, vor allem zu Kosten- und Leistungsrechnung sowie zu Investitionsrechnung.
|
|
weitere Fachbeiträge des Autors
| Forenbeiträge
|







 Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.
Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT. Wie erstelle ich ein Tacho- oder Ampel-Diagramm? Wie kann ich Abweichungen in Tabellen ansprechend visualisieren? Das wird Ihnen hier anschaulich erklärt.
Wie erstelle ich ein Tacho- oder Ampel-Diagramm? Wie kann ich Abweichungen in Tabellen ansprechend visualisieren? Das wird Ihnen hier anschaulich erklärt.  Viel ist zum Berichtswesen oder Reporting schon geschrieben worden. Dennoch zeigen Umfragen, dass rund 50 Prozent der Empfänger von Berichten mit dem Reporting nicht zufrieden sind. Jörgen Erichsen erklärt in diesem Buch die Bedeutung und die Handhabung des Berichtswesens speziell für kleinere Betriebe. Mit zahlreichen Beschreibungen, Beispielen und Checklisten.
Viel ist zum Berichtswesen oder Reporting schon geschrieben worden. Dennoch zeigen Umfragen, dass rund 50 Prozent der Empfänger von Berichten mit dem Reporting nicht zufrieden sind. Jörgen Erichsen erklärt in diesem Buch die Bedeutung und die Handhabung des Berichtswesens speziell für kleinere Betriebe. Mit zahlreichen Beschreibungen, Beispielen und Checklisten.

 Sie lieben, wenn am Monatsende alles stimmt? Paragraphen schrecken Sie nicht ab und ein Umfeld, in dem man sich gegenseitig unterstützt, ist kein Fremdwort? Dann sind Sie genau richtig bei uns – wo die Abrechnung nicht nur korrekt ist. Mehr Infos >>
Sie lieben, wenn am Monatsende alles stimmt? Paragraphen schrecken Sie nicht ab und ein Umfeld, in dem man sich gegenseitig unterstützt, ist kein Fremdwort? Dann sind Sie genau richtig bei uns – wo die Abrechnung nicht nur korrekt ist. Mehr Infos >>
 Essendi steht für mehr als den reinen Hotelbetrieb – wir schaffen die Dynamik, die Hotels erfolgreich macht. Als europäischer Marktführer im Economy- und Midscale-Segment investieren und agieren wir mit einem klaren Ziel: jede unserer Immobilien in einen nachhaltigen, lebendigen und bedeutungsvol... Mehr Infos >>
Essendi steht für mehr als den reinen Hotelbetrieb – wir schaffen die Dynamik, die Hotels erfolgreich macht. Als europäischer Marktführer im Economy- und Midscale-Segment investieren und agieren wir mit einem klaren Ziel: jede unserer Immobilien in einen nachhaltigen, lebendigen und bedeutungsvol... Mehr Infos >>
 Wir sind ein kleines, aber wachsendes Familienunternehmen aus Neckartailfingen und realisieren Reinräume sowie innovative Prozessumgebungen für spannende Branchen wie Lebensmittel, Pharma, Medizintechnik, Mikrotechnik, Kosmetik und viele mehr. Das Besondere: Mit unseren Anlagen ents... Mehr Infos >>
Wir sind ein kleines, aber wachsendes Familienunternehmen aus Neckartailfingen und realisieren Reinräume sowie innovative Prozessumgebungen für spannende Branchen wie Lebensmittel, Pharma, Medizintechnik, Mikrotechnik, Kosmetik und viele mehr. Das Besondere: Mit unseren Anlagen ents... Mehr Infos >>
 Bist Du mit an Bord, wenn es um Nachhaltigkeit und das Erreichen der Klimaziele geht? Dann leiste jetzt bei Techem Deinen aktiven Beitrag dazu, wertvolle Ressourcen zu schonen. Wir sorgen gemeinsam für die digitale Energiewende in Gebäuden. Als ein führender Servicepartner für smarte und nachhalt... Mehr Infos >>
Bist Du mit an Bord, wenn es um Nachhaltigkeit und das Erreichen der Klimaziele geht? Dann leiste jetzt bei Techem Deinen aktiven Beitrag dazu, wertvolle Ressourcen zu schonen. Wir sorgen gemeinsam für die digitale Energiewende in Gebäuden. Als ein führender Servicepartner für smarte und nachhalt... Mehr Infos >>
 NIEHOFF ist ein erfolgreiches deutsches, mittelständisches Unternehmen mit internationalen Strukturen und Tradition im Bereich des Sondermaschinenbaus. Mit eigenen Tochtergesellschaften und Niederlassungen in den USA, Brasilien, China, Indien, Tschechien, Schweden, Singapur, Japan, Spanien... Mehr Infos >>
NIEHOFF ist ein erfolgreiches deutsches, mittelständisches Unternehmen mit internationalen Strukturen und Tradition im Bereich des Sondermaschinenbaus. Mit eigenen Tochtergesellschaften und Niederlassungen in den USA, Brasilien, China, Indien, Tschechien, Schweden, Singapur, Japan, Spanien... Mehr Infos >>
 In der ALTANA Gruppe arbeiten Sie in einer einzigartigen Innovationskultur, in der die Förderung individueller Ideen und Fähigkeiten und ein offenes, vertrauensvolles Miteinander großgeschrieben werden. BYK-Gardner bietet Ihnen eine Menge Vorteile. Im Detail: eine angenehme Betriebsgröße, in der ... Mehr Infos >>
In der ALTANA Gruppe arbeiten Sie in einer einzigartigen Innovationskultur, in der die Förderung individueller Ideen und Fähigkeiten und ein offenes, vertrauensvolles Miteinander großgeschrieben werden. BYK-Gardner bietet Ihnen eine Menge Vorteile. Im Detail: eine angenehme Betriebsgröße, in der ... Mehr Infos >>
 Das Globana Village am Flughafen Leipzig/Halle besteht aus dem „Fashion-Campus“ um das MMC Mitteldeutsches Mode Center, welches mit über 200 Showrooms namhafter Modemarken und seinen Modemessen die zentrale Distributions- und Beschaffungsplattform für die Modeindustrie und den Modefachhandel in d... Mehr Infos >>
Das Globana Village am Flughafen Leipzig/Halle besteht aus dem „Fashion-Campus“ um das MMC Mitteldeutsches Mode Center, welches mit über 200 Showrooms namhafter Modemarken und seinen Modemessen die zentrale Distributions- und Beschaffungsplattform für die Modeindustrie und den Modefachhandel in d... Mehr Infos >>
 PlanET Biogastechnik GmbH plant, entwickelt und konstruiert Biogasanlagen für Landwirtschaft sowie Industrie im nationalen wie auch internationalen Markt. Auf unserem erfolgreichen Weg brauchen wir dich als Verstärkung. Bringe deine Ideen bei uns ein und verwirkliche dich bei uns. In unserem fami... Mehr Infos >>
PlanET Biogastechnik GmbH plant, entwickelt und konstruiert Biogasanlagen für Landwirtschaft sowie Industrie im nationalen wie auch internationalen Markt. Auf unserem erfolgreichen Weg brauchen wir dich als Verstärkung. Bringe deine Ideen bei uns ein und verwirkliche dich bei uns. In unserem fami... Mehr Infos >>






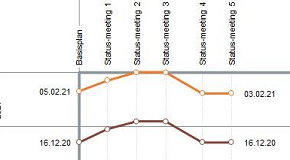

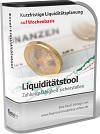 Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>
Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>