![Green Controlling als Teil einer integrierten Unternehmenssteuerung]()
Das Thema
Nachhaltigkeit ist in aller Munde, so auch in der Betriebswirtschaftslehre. Inzwischen ist der Begriff auch im
Controlling angekommen. Unternehmen können es sich nicht mehr leisten, nachhaltige Aspekte zu ignorieren (z. B. in der Beschaffung, in der Produktion oder im Marketing). Doch was bedeutet es, Nachhaltigkeit im Controlling zu berücksichtigen oder gar die Unternehmessteuerung nachhaltig auszurichten? Dieser Artikel analysiert die Idee und die zentralen Aspekte eines nachhaltigen Controllings, auch
Green Controlling genannt. Außerdem werden die möglichen Implikationen eines Green Controllings auf eher traditionell ausgerichtete Controlling Ansätze behandelt.
Anzeige
Neben aktuellen Fach- und Arbeitsmarkt-Trends für Controller und neu eingegangene Fachbeiträge, informieren wir Sie über interessante Veranstaltungen und stellen Ihnen einzelne Software- Produkte im Detail vor. Werden Sie jetzt monatlich über neue Fachbeiträge, Controlling-Tools und News informiert! Zur Newsletter-Anmeldung >>
Controlling Instrumente werden seit vielen Jahrzehnten in ganz unterschiedlichen Organisationen angewendet - vom kleinen Mittelständler bis zum multinationalen Unternehmen, in privatwirtschaftlich orientierten Unternehmen und in non-profit Organisationen etc. Zu den
zentralen Aufgaben von Controllern zählen die Sammlung, Auswertung und Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen für das Management.
Entscheidungsträger werden dabei durch ein transparentes und zeitnahes Management
Reporting unterstützt, das betriebswirtschaftlich relevante Daten strukturiert zur Verfügung stellt. Durch den Einsatz von Planungs- und Kontrollinstrumenten soll die Zielerreichung steuernd gewährleistet werden (vgl. Horváth/Gleich/Seiter, 2024, S. 26-57; Weber/Schäffer, 2022, S. 39f.).
In den letzten Jahren wird von Unternehmen verstärkt die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit gefordert. Dies hat inzwischen auch Eingang in die
Betriebswirtschaftslehre gefunden (vgl. beispielhaft Ernst/Sailer/Gabriel, 2021).
Da das Controlling eine
Kernfunktion der Betriebswirtschaftslehre darstellt, ergibt sich die Frage, wie ein nachhaltiges Controlling bzw. ein Green Controlling ("grünes Controlling" oder Ökocontrolling) ausgestaltet werden soll und was der Grundgedanke dahinter ist. Diese Fragen sollen in dem vorliegenden Artikel näher betrachtet werden.
Idee des Green Controllings
Erste Ansätze zum Green Controlling lassen sich bis in die
1990er Jahre zurückverfolgen. Allgemein kann man darunter solche Controlling-Aktivitäten verstehen, die ein Nachhaltigkeitsmanagement und eine nachhaltige Unternehmensentwicklung gezielt unterstützen. Damit ist die Grundausrichtung zunächst sehr ähnlich wie im Vergleich zu eher traditionellen Controlling-Konzeptionen (z. B. koordinationsorientierte oder rationalitätsorientierte Ansätze), nämlich die
Informationsversorgung von Entscheidungsträgern sicherzustellen.
Der besondere
Schwerpunkt des Green Controllings liegt jedoch im Bereich von ökologisch relevanten Informationen und deren sinnvolle Integration in ein Management Berichtswesen. Hierbei sollten die folgenden drei Perspektiven der Nachhaltigkeit (sog. 3-SäulenModell) besonders berücksichtigt werden: die ökonomische, die ökologische und die soziale Perspektive.
Die
ökonomische Perspektive beschreibt inwieweit für nachfolgende Generationen eine tragfähige Grundlage für Erwerb und Wohlstand vorhanden sein sollte. Die
ökologische Perspektive betont Natur und Umwelt sowie deren Erhaltung für die Zukunft. Inhalt der
sozialen Perspektive ist es, eine Gesellschaft zu erhalten, die dauerhaft als lebenswert angesehen werden kann (vgl. Sailer, 2024, S. 18-23). Der Grundgedanke der Nachhaltigkeit liegt folglich darin, ein ökologisches System so zu nutzen, dass es in seinen wesentlichen Eigenschaften für künftige Generationen erhalten bleibt und sich selbst regenerieren kann.
Aufgaben des Green Controllings
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass es keinen allgemeingültigen Typ eines Green Controllings gibt, der direkt im Unternehmen implementiert werden kann. Die Ansätze und Aufgabenstellungen in der Praxis sind dafür zu komplex und vielschichtig. Ein erster Ansatzpunkt zur Implementierung eines Green Controllings besteht darin etablierte Controlling-Prozesse und -Instrumente um Nachhaltigkeitsaspekte zu erweitern und zu ergänzen.
Eine zentrale
Vorbedingung zur Implementierung des Green Controllings betrifft außerdem die Organisation der Controllingabteilung selbst, insbesondere die
Aufbauorganisation. Es ist wenig sinnvoll diese einfach um einen eigenen (neuen) Bereich "Green Controlling" o. ä. zu erweitern. Dies würde eine integrierte Unternehmenssteuerung aus einer Hand (d. h. einschließlich der Nachhaltigkeitsaspekte) konterkarieren (vgl. Sailer, 2024, S. 93f.). Es ist vielmehr ein kontextspezifisches und schrittweise integrierendes Vorgehen angeraten.
Aus
strategischer Perspektive besteht eine zentrale Aufgabe des Green Controllings in der Unterstützung einer ökologisch ausgerichteten Strategie- und Zielbildung. Dabei sind solche strategischen Erfolgspotenziale zu identifizieren und zu konkretisieren, die Randbedingungen für künftige Erfolgs- und Liquiditätswirkungen erkennen lassen. Hilfreich hierfür sind Markt- und Wettbewerbsanalysen unter Berücksichtigung von ökologischen Aspekten.
Eine weitere wichtige Aufgabe des Green Controllings ist ein
ökologieorientiertes Messen,
Analysieren und
Bewerten von betriebswirtschaftlichen Sachverhalten. Ähnlich wie beim "traditionellen" Controlling bietet sich hier die Entwicklung geeigneter
Kennzahlen bzw. Kennzahlensysteme an. Allerdings sollte der besondere Schwerpunkt auf den potenziellen Umweltwirkungen liegen. Als mögliche Instrumente können ökologisch nachhaltige Investitionsrechnungen oder Öko-Balanced Scorecards in Erwägung gezogen werden. Auf die möglichen Instrumente eines Green Controllings wird weiter untern noch näher eingegangen.
Als
Querschnittsaufgabe bei einem Green Controlling-Ansatz könnte eine
bereichsübergreifende Beratung ausgebaut werden. Dies beinhaltet die Beratung und Sensibilisierung von verschiedenen Anspruchsgruppen im Unternehmen in Bezug auf Umweltaspekte und deren Wirkungen. Hierbei geht es in einem ersten Schritt zunächst um das Bewusstmachen und Hinterfragen von ökologischen und ökonomischen Wechselwirkungen. In weiteren Schritten könnten dann Verbesserungen und Optimierungen angestrebt werden. Sollte ein Unternehmen über etablierte Umwelt- oder Nachhaltigkeitsmanager verfügen, wäre eine Zusammenarbeit zwischen diesen und dem Controlling eine sinnvolle Ergänzung.
Da die Nachhaltigkeitsthematik für Controller häufig eine neue (und zum Teil etwas ungewohnte) Materie darstellt, sind im Vorfeld geeignete
Schulungsmaßnahmen unabdingbar. Auch im weiteren Verlauf sind permanente nachhaltigkeitsspezifische Schulungen notwendig.
Instrumente des Green Controllings
Um die Ziele und Aufgaben eines Green Controllings im Unternehmen zu unterstützen, ist der Einsatz verschiedener Instrumente möglich. Diese lassen sich je nach
Entwicklungsstufe in drei Gruppen einordnen. In der ersten Gruppe sind traditionelle Methoden anzutreffen. Diese Methoden legen neben betriebswirtschaftlichen Aspekten einen weiteren Fokus auf ökologische Gesichtspunkte. Zu nennen sind hier hauptsächlich längerfristig orientierte Methoden des Kostenmanagements wie zum Beispiel die Prozesskostenrechnung (Activitybased Costing), die Lebenszykluskostenrechnung (Life Cycle Costing) und die Zielkostenrechnung (Target Costing). Wie bereits erwähnt werden insbesondere ökologische Aspekte bei diesen Analysen mitberücksichtigt.
Zur
zweiten Gruppe gehören solche Instrumente, die in Bezug auf Umweltwirkungen weiterentwickelter und detaillierter sind als diejenigen der ersten Gruppe. Umweltwirkungen und externe Effekte werden hierbei als wesentliche Einflussgrößen betrachtet. Beispielsweise stellt der
Schadenskostenansatz den in Geldeinheiten ausgedrückten Schaden, der durch eine Umweltschädigung entsteht, in den Vordergrund. Dieser wird relativ häufig von Unternehmen angewendet.
Eine zweite wichtige Methode ist der so genannte
Vermeidungskostenansatz. Davon ausgehend, dass Verschlechterungen der Umweltqualität bei den Betroffenen Anpassungshandlungen auslösen, könnten die hierfür (potentiell) anfallenden Kosten als möglichen Anhaltswert für die Umweltschädigung verwendet werden. Beide Methoden lassen sich mit einer
Ökobilanz kombinieren, so dass auf systematische Weise die Umweltwirklungen, z. B. von Produkten während des gesamten Lebenszyklus, analysiert werden können. Kritisch ist anzumerken, dass es nicht immer ganz einfach ist, tatsächliche oder potenzielle Umweltschäden genau zu ermitteln und zu quantifizieren.
In die
dritte Gruppe fallen sehr spezifische Ansätze und Instrumente, die Umweltwirkungen sichtbar und bewertbar machen. Hierzu zählen z. B. Stoff- und Energiebilanzen, die das Verhältnis zwischen sinnvoller Nutzung und Verbrauch von Energie mit Blick auf ökologische Auswirkungen darstellen. Eines der wichtigsten Instrumente ist der so genannte Carbon Footprint (CO
2-Fußabdruck). Dabei werden alle
klimawirksamen Treibhausgase erfasst und in einer so genannten Treibhausgasbilanz zusammengestellt.
Der
Energieeinsatz wird dadurch transparent, da sämtliche Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette systematisch und detailliert erfasst werden. In ähnlicher Weise kann der so genannte
Water Footprint (Wasserfussabdruck) verstanden werden. Dies ist die Gesamtmenge an Wasser, die ein Unternehmen in einer bestimmten Periode verbraucht. Hierbei wird neben dem direkten Wasserverbrauch auch der indirekte Verbrauch mit eingerechnet, z. B. durch Verschmutzung oder durch Verdunsten (vgl. Sailer, 2024, S. 176-209)
Insgesamt sollten Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Instrumente situativ und überlegt vorgehen. Ähnlich wie bei klassischen Kennzahlen ist es im Vorfeld wichtig die Bedeutung und Aussagekraft von Instrumenten sowie mögliche
Wirkungszusammenhänge transparent zu machen.
Fazit
Angesichts der Herausforderungen durch den weltweiten Klimawandel könnte sich das Green Controlling in Zukunft zu einem sehr spannenden und kaum zu ignorierenden Themenfeld für Unternehmen entwickeln. Trotz alle dem wird sich das Green Controlling sehr wahrscheinlich nicht zu einer gesonderten Controllingfunktion hin entwickeln, die von Spezialisten vertreten wird. Das sollte es auch nicht. Vielmehr sollte es als
integraler Bestandteil eines
Gesamt-Unternehmenscontrollings aufgefasst werden.
Controller sollten sich daher das erforderliche ökologische
Fachwissen und die notwendigen
Qualifikationen aneignen. Nur dann können sie als kompetente Ansprechpartner auftreten und werden als Business Partner ernst genommen. Zudem tragen sie erst dann eine echte Mitverantwortung bei der Zielerreichung – vor allem in ökologischer Hinsicht.
Quellen:
- Ernst, Dietmar/Sailer, Ulrich/Gabriel, Robert (Hrsg.) (2021): Nachhaltige Betriebswirtschaft, 2. Aufl., Tübingen.
- Horváth, Péter/Gleich, Ronald/Seiter, Mischa (2024): Controlling, 15. Aufl., München.
- Sailer, Ulrich (2024): Nachhaltigkeitscontrolling, 5. Aufl., München.
- Weber, Jürgen/Schäffer, Utz (2022): Einführung in das Controlling, 17. Aufl., Stuttgart.
Der Verfasser:
Prof. Dr. Peter Werner lehrt Allgemeine Betriebswirtschaftslehre insbesondere Rechnungswesen und Controlling an der Frankfurt University of Applied Sciences. E-Mail:
[email protected]
letzte Änderung M.R.
am 26.05.2025
Autor:
Prof. Peter Werner
|






 Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.
Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT. Wie erstelle ich ein Tacho- oder Ampel-Diagramm? Wie kann ich Abweichungen in Tabellen ansprechend visualisieren? Das wird Ihnen hier anschaulich erklärt.
Wie erstelle ich ein Tacho- oder Ampel-Diagramm? Wie kann ich Abweichungen in Tabellen ansprechend visualisieren? Das wird Ihnen hier anschaulich erklärt.  Viel ist zum Berichtswesen oder Reporting schon geschrieben worden. Dennoch zeigen Umfragen, dass rund 50 Prozent der Empfänger von Berichten mit dem Reporting nicht zufrieden sind. Jörgen Erichsen erklärt in diesem Buch die Bedeutung und die Handhabung des Berichtswesens speziell für kleinere Betriebe. Mit zahlreichen Beschreibungen, Beispielen und Checklisten.
Viel ist zum Berichtswesen oder Reporting schon geschrieben worden. Dennoch zeigen Umfragen, dass rund 50 Prozent der Empfänger von Berichten mit dem Reporting nicht zufrieden sind. Jörgen Erichsen erklärt in diesem Buch die Bedeutung und die Handhabung des Berichtswesens speziell für kleinere Betriebe. Mit zahlreichen Beschreibungen, Beispielen und Checklisten.
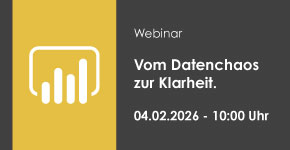
 Das Max-Planck-Institut für Geoanthropologie (MPI‑GEA) in Jena wurde im Sommer 2022 gegründet und ist ein dynamisch wachsendes, hochgradig internationales und interdisziplinär ausgerichtetes Forschungsinstitut. Es besteht aktuell aus drei Abteilungen sowie mehreren Forschungsgruppen, ze... Mehr Infos >>
Das Max-Planck-Institut für Geoanthropologie (MPI‑GEA) in Jena wurde im Sommer 2022 gegründet und ist ein dynamisch wachsendes, hochgradig internationales und interdisziplinär ausgerichtetes Forschungsinstitut. Es besteht aktuell aus drei Abteilungen sowie mehreren Forschungsgruppen, ze... Mehr Infos >>
 Sie lieben, wenn am Monatsende alles stimmt? Paragraphen schrecken Sie nicht ab und ein Umfeld, in dem man sich gegenseitig unterstützt, ist kein Fremdwort? Dann sind Sie genau richtig bei uns – wo die Abrechnung nicht nur korrekt ist. Mehr Infos >>
Sie lieben, wenn am Monatsende alles stimmt? Paragraphen schrecken Sie nicht ab und ein Umfeld, in dem man sich gegenseitig unterstützt, ist kein Fremdwort? Dann sind Sie genau richtig bei uns – wo die Abrechnung nicht nur korrekt ist. Mehr Infos >>
 Sie denken strategisch, arbeiten präzise und behalten auch bei komplexen Themen den Überblick? Dann sind Sie genau richtig bei uns – bauen Sie mit uns das Rückgrat unseres Maklerhauses aus und übernehmen Sie die Verantwortung für unsere Buchhaltung. Mehr Infos >>
Sie denken strategisch, arbeiten präzise und behalten auch bei komplexen Themen den Überblick? Dann sind Sie genau richtig bei uns – bauen Sie mit uns das Rückgrat unseres Maklerhauses aus und übernehmen Sie die Verantwortung für unsere Buchhaltung. Mehr Infos >>
 ONTRAS betreibt 7.700 Kilometer Fernleitungsnetz in Ostdeutschland. Wir transportieren Erdgas und grüne Gase zu unseren Kunden, den nachgelagerten Netzbetreibern wie Stadtwerken und Industriekunden. Über 500 Mitarbeiter*innen bringen ihr Know-how am Leipziger Hauptsitz und an 12 weiteren Standort... Mehr Infos >>
ONTRAS betreibt 7.700 Kilometer Fernleitungsnetz in Ostdeutschland. Wir transportieren Erdgas und grüne Gase zu unseren Kunden, den nachgelagerten Netzbetreibern wie Stadtwerken und Industriekunden. Über 500 Mitarbeiter*innen bringen ihr Know-how am Leipziger Hauptsitz und an 12 weiteren Standort... Mehr Infos >>
 PlanET Biogastechnik GmbH plant, entwickelt und konstruiert Biogasanlagen für Landwirtschaft sowie Industrie im nationalen wie auch internationalen Markt. Auf unserem erfolgreichen Weg brauchen wir dich als Verstärkung. Bringe deine Ideen bei uns ein und verwirkliche dich bei uns. In unserem fami... Mehr Infos >>
PlanET Biogastechnik GmbH plant, entwickelt und konstruiert Biogasanlagen für Landwirtschaft sowie Industrie im nationalen wie auch internationalen Markt. Auf unserem erfolgreichen Weg brauchen wir dich als Verstärkung. Bringe deine Ideen bei uns ein und verwirkliche dich bei uns. In unserem fami... Mehr Infos >>
 Sie möchten die Finanz- und Rechnungswesen-Prozesse einer internationalen Unternehmensgruppe aktiv mitgestalten? Sie haben Erfahrung in der Erstellung von Abschlüssen und suchen eine verantwortungsvolle Position mit Entwicklungsmöglichkeiten? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Mehr Infos >>
Sie möchten die Finanz- und Rechnungswesen-Prozesse einer internationalen Unternehmensgruppe aktiv mitgestalten? Sie haben Erfahrung in der Erstellung von Abschlüssen und suchen eine verantwortungsvolle Position mit Entwicklungsmöglichkeiten? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Mehr Infos >>
 Das Q in EQOS steht für „Quality“ und hat viele Gesichter. Eines davon ist „Motivation“: Unsere Mitarbeitenden spornen sich immer wieder selbst an und finden für unterschiedlichste Aufgaben vielfältige Lösungen. Mit ihren kreativen Ideen bringen sie uns voran und machen EQOS zu einem spannenden u... Mehr Infos >>
Das Q in EQOS steht für „Quality“ und hat viele Gesichter. Eines davon ist „Motivation“: Unsere Mitarbeitenden spornen sich immer wieder selbst an und finden für unterschiedlichste Aufgaben vielfältige Lösungen. Mit ihren kreativen Ideen bringen sie uns voran und machen EQOS zu einem spannenden u... Mehr Infos >>
 Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>


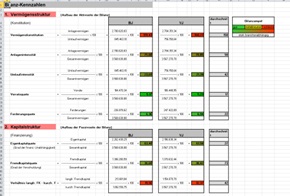




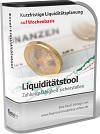 Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>
Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>